Später experimentelle Künstler versuchten sich am Pop
Fangen wir mit den beiden Künstlern an, die mich zu diesem Artikel inspiriert haben: Genesis und David Bowie. In beiden Fällen wurde die Karriere mit einem Pop-Album gestartet, das floppte und aus heutiger Sicht nicht mal mehr für Nostalgie zu gebrauchen ist. Weder „From Genesis to Revelation“ noch David Bowies selbstbetiteltes Debut zeigten den kreativen Wagemut, den es Ende der 60er gebraucht hätte. Genesis Zweitwerk „Trespass“ war dann schon ein qualitativer Quantensprung im Vergleich und David Bowie konnte auf seinem zweiten Album mit Space Oddity immerhin einen richtigen Hit landen. Aber auch bei anderen Künstlern sah es ähnlich aus. Auf „The Magnificent Moodies“ von The Moody Blues ist noch nichts vom dem progressiven Sound á la Nights in White Satin zu hören. Stattdessen gibt es typische mid-60s Beat-Musik, ohne wirklichen Wiedererkennungswert. Eine andere Band lieferte hingegen gerade erst einen großen Hit auf einem auch sonst soliden Album: Status Quo mit dem psychedelischen „Pictures of Matchstick Men“. Das zweite Album der Band war hingegen ein herber Rückschritt. „Spare Parts“ fiel deutlich poppiger aus und man wollte in der Produktion auf „Nummer Sicher“ gehen – mit gegenteiligem Ergebnis. Das Album hat kaum Bekanntheitsgrad und das zurecht. Deep Purple hatten mit „Hush“ zwar ebenfalls schon früh einen großen Hit, aber abseits davon ist auf dem Debutwerk „Shades of Deep Purple“ sehr seichte Kost enthalten. Cover von den Beatles und Jimi Hendrix standen an, Hauptsache es erschien Massentauglich. Das Nachfolgealbum „Books of Taliesyn“ erschien gerade Mal drei Monate später, wodurch es einen ähnlichen Charakter besitzt, ein denkbar schlechter Start, aber spätestens mit dem dritten Album, das schlicht nach der Band benannt wurde, ging es dann bergauf.
In den 60ern war sie zwar schon ein großer Star mit tollen Alben, doch auch Marianne Faithfull leistete sich einen Ausrutscher in ihrer folkigen Ära. „Love in a Mist“ bekam kitschige Arrangements um seichter zu wirken und ein breiteres Publikum anzusprechen. Aus heutiger Sicht absolut gruselig anzuhören.
Zu experimentelle Künstler
Andersherum geht es natürlich auch. Gerade in den späten 60ern wurde die Musik immer experimenteller. Es wurde mehr ausprobiert und erforscht und neben vielen tollen neuen Möglichkeiten gab es dann auch immer wieder Irrwege.
Pink Floyd waren in ihrer Anfangszeit noch sehr experimentierfreudig und ließen wenig unversucht. Nach dem Bruch mit dem ehemaligen Bandleader Syd Barrett widmete sich die Band dem Soundtrack „More“. Durchaus ambitioniert, aber dennoch viel zu unausgereift. Abseits vom „Nile Song“ bleibt leider nicht viel, was sich ohne die entsprechenden Filmbilder anzuhören lohnt.
Wo wir bei experimentellen Acts der 60er sind, darf natürlich eine Band nicht unerwähnt bleiben: Die Beatles. Während das Liverpooler Quartett quasi unaufhaltsam die Musikwelt revolutionierte, starteten alle Solokarrieren recht schwierig. Das berühmteste Beispiel hierfür ist wohl die missglückte Alben-Trilogie von John Lennon. Zusammen mit Yoko Ono sang (oder schrie oder flüsterte, was auch immer…) er drei Avant-garde Alben ein. Einen roten Faden sucht man vergebens. Von Struktur oder einer klaren Richtung fehlt jede Spur. Für die beiden machten „Unfinished Music No. 1 & 2“ sowie das „Wedding Album“ durchaus Sinn, aber Außenstehende können nur in den seltensten Fällen etwas damit anfangen.
Etwas besser lief es für George Harrison, der mit „Wonderwall Music“ ein zwar nicht ganz schlechtes, aber dennoch etwas schwieriges Klangexperiment – ebenfalls für einen Film – wagte. Auf Dauer ist das sehr ermüdend, aber nichts im Vergleich zu seinem Zweitwerk „Electronic Sound“. Habt ihr schonmal aus Langeweile an dem Eingangskabel von einem Lautsprecher rumgespielt, weil das so lustige Geräusche macht? Nun, George Harrison hatte das wohl mal. Und aus irgendwelchen Gründen war er davon so begeistert, dass er es als Album aufnahm. Ja… eine Dreiviertelstunde nur unregelmäßiges Gebrumme aus einem Lautsprecher, das ist so angenehm zu hören, wie es in der Theorie klingt.
Neue Sachen ausprobieren ist ja gerne gesehen, aber dann doch bitte etwas ambitionierter, wie bei einer gewissen Münchner Gruppierung…
Amon Düül II machten schon vor wenig halt, aber die Alben des Schwesterprojekts Amon Düül gelten im Allgemeinen als unanhörbar. Das hat einen einfachen Grund: die Mitglieder der Band konnten alle keine Instrumente spielen und bekamen einfach das Instrument zugeteilt, das sie gerne spielen wollten. Es ging der Formation mehr darum ihren Ideen als Freigeister Ausdruck zu verleihen, als darum ernsthafte Musik zu praktizieren. Somit sind die 60er Werke „Psychedelic Underground“ und „Singvögel Rückwärts“ ein heilloses Durcheinander von schiefen Klängen. Wer es braucht…
Belangloser Rock n‘ Roll
The Guess Who gelten als Paradebeispiel einer großen Classic Rock Band, aber die ersten drei Alben der Band? „Shakin‘ All Over“, „It’s Time“ und vor allem „Hey Ho“ werden heute kaum thematisiert, eher wird so getan als wäre Wheatfield Soul das Debut der Band. Der Grund: die Band spielte in ihren Anfangstagen Beat-Musik – aber keine originelle oder welche mit viel Wiedererkennungswert. Die Platten sind klischeehaft und wirken teils eher wie eine Karikatur. Apropos Karikatur: Frank Zappa war bekannt dafür diverse Musikstile und Szenen zu parodieren. Im Großen und Ganzen kam das bei seinen Fans auch immer gut an, nur mit einer Platte seiner 60er-Schaffensphase verschreckte er selbst die Hardliner: „Cruising with Ruben & The Jets“. Der Humor der Platte ist ähnlich wie auf seinen anderen Werken, aber musikalisch ist das leider sehr belangloser Doo-Wop. Ein Jammer für das vergeudete Talent.
Aber auch in Großbritannien war dieses Phänomen sichtbar: Die Kinks hatten zwar viele Achtungserfolge zu verzeichnen, aber auch ein Gurken. Aufgrund ihrer vielen Veröffentlichungen in den 60ern hatten einige Alben einen Hit und sonst nur Rock n‘ Roll-Füllmaterial. Dazu zählen vor allem „You Really Got Me“, „Kinks-Size“ und „Kinkdom“.
Der Vollständigkeit halber sollte auch „Their First LP“ von der Spencer Davis Group erwähnt sein. Klar, die Gruppe hatte nie den Ruf außerordentlich gut zu sein, aber die Hits kamen erst auf den folgenden Alben.
Fehlender Wagemut von Singer-Songwritern
Fast alle Debutalben der bekannten Singer-Songwriter stehen in einer Linie. Die Künstler wirkten oft zaghaft, während die Texte später oft bissig und politisch waren, versuchte man sich an Geschichten aus der breiten Bevölkerung oder auch persönlichen Erfahrungen. Obendrein kamen noch sehr viele Cover von Traditionals hinzu. Gerade auf dem selbstbenannten Debut von Bob Dylan wird das deutlich, aber auch auf Joan Baez Debut „Folksingers ‚Round Harvard Square“ (Anm. eigentlich aus den 50ern, passt aber in diese Kategorie) wird das deutlich. Etwas besser fiel es bei Simon & Garfunkels „Wednesday Morning, 3 A.M.“ oder auch bei Neil Youngs Debut aus. Aber auch hier zeigten die späteren Veröffentlichungen dass mehr möglich gewesen wäre. Auch bei rockigeren Songwritern zeichnete sich das leider ab: Alice Cooper bzw. die Alice Cooper Group war noch weit von ihrem Image als Horror-Ikonen entfernt und versuchte sich auf dem gefloppten Debut an simplen Garage-Rock. Und der spätere Rock n‘ Roll-Star Bob Seger versuchte mit „Noah“ eine Art Neustart als das eigentliche Debut nicht den erhofften Erfolg brachte. Statt Seger in den Mittelpunkt zu stellen, bekam er hier den Singer-Songwriter Tom Neme an die Seite und teilte sich mit ihm den Leadgesang. Keine gute Idee, von Neme hörte man seitdem kaum noch etwas.
Schlechte Qualität von Live-Alben
Die 70er Jahre gelten als Hochzeit der Live-Alben, in den 60ern waren große Live-Alben eher die Ausnahme. Der Hauptgrund war natürlich der technische Stand der Zeit, der zu mangelhafter Audioqualität bei Mitschnitten führte. Berühmt-berüchtigt aus der Zeit sind die Postumen „Cheaper Thrills“ und „The Lost Tapes“ von Janis Joplin und auch „Experience“ von Jimi Hendrix.
Aber auch die Beach Boys wollten ihr Livekönnen veröffentlichen. „Beach Boys Concert“ zeigt zudem nochmal sehr schön wie das Kreischen und Jubeln des Publikums die damalige Technik zum übersteuern brachte. Also machten die Beach Boys es sich ein Jahr später deutlich einfacher: „Beach Boys Party“ wurde im Studio aufgenommen und für die Live-Atmosphäre wurden angebliche Gäste im Nachhinein dazu gemischt, es wurden Patzer und kleine Fehlerchen beabsichtigt eingespielt und obendrein ist die Songauswahl mitunter unpassend.
…
Und zu guter Letzt noch zwei Alben, die nicht so ganz in die anderen Kategorien passen.
Zum einen hätten wir ein Album, das bis heute als eines der schlechtesten aller Zeiten gilt: „Philosophy of the World“ von den Shaggs. Die Instrumente waren allesamt nicht gestimmt, die Musikerinnen hatten keinerlei musikalisches Können, die Texte wirkten unbeholfen und alle schienen durcheinander zu spielen – Da konnte auch der Sound-Ingenieur nichts mehr richten. Dennoch (oder gerade deswegen) gibt es einige prominente Fans des Werkes. Wenig überraschend war Frank Zappa ein Bewunderer der zweifelhaften Kunst, ebenso Kurt Cobain.
Zum anderen sollte noch „Speedway“ von Elvis Presley erwähnt sein. Ende der 60er brach die Karriere von Presley rasant ein. Rock n‘ Roll war nicht mehr gefragt, ebenso die Elvis-Kinofilme. „Speedway“ war der letzte Filmsoundtrack von Presley und läutete auch langsam aber sicher das Ende der Elvis-Filme ein. Die ganze Angelegenheit wirkt völlig aus der Zeit gefallen und Presley selbst wirkt als hätte er den Zeitenwandel nicht mitbekommen. Ebenso war das die letzte Filmrolle von Nancy Sinatra – somit gleich der doppelte Karriere-Killer.
Die dunkle Seite der 60er Alben
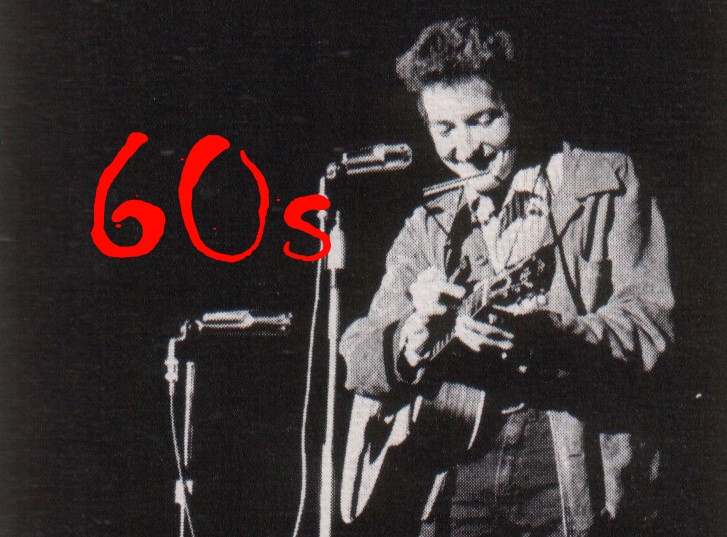









+ There are no comments
Add yours